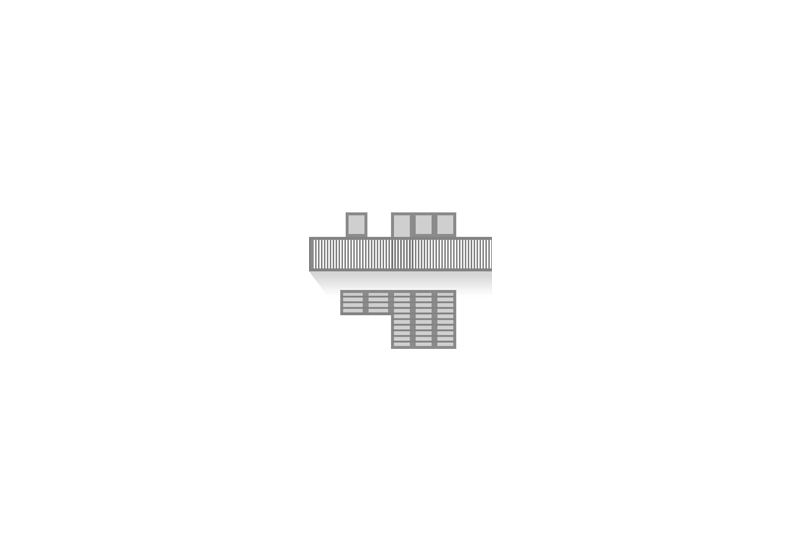
Blick durch die Siedlung
Martin Gerlach jun. © Wien Museum
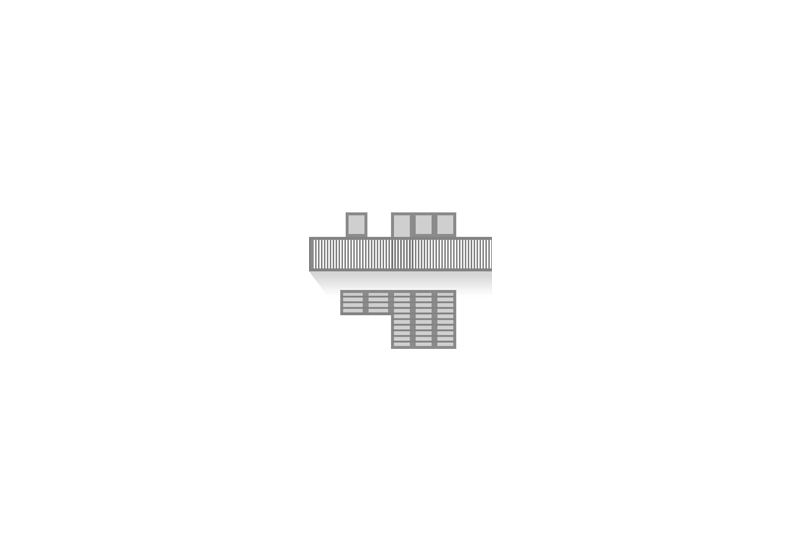
Gartenfassage
Martin Gerlach jun. © Wien Museum
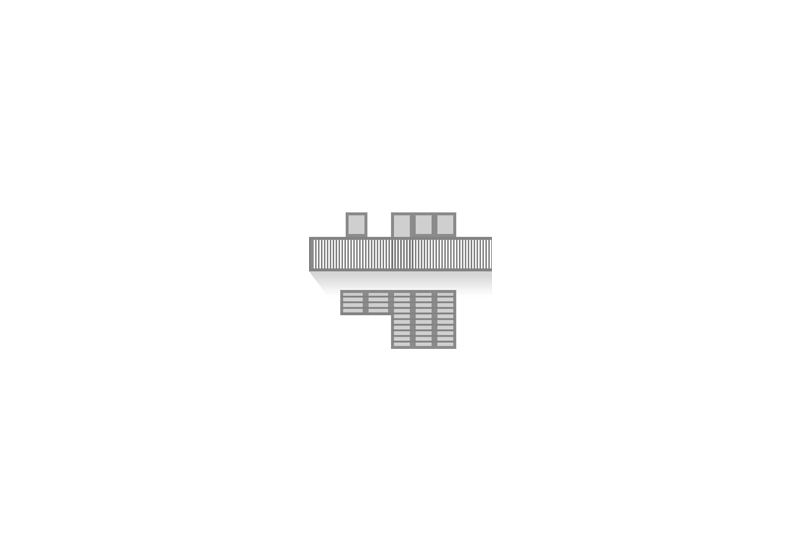
Westansicht
Martin Gerlach jun. © Wien Museum
Das Gartenkonzept
Obwohl die Wiener Werkbundsiedlung in zeitgenössischen Berichten mitunter als „Gartenstadt“ bezeichnet wurde, ist dieser Begriff irreführend. Die Werkbundsiedlung war eine Ausstellung von Kleinhäusern mit Garten auf einem von der Stadt Wien zur Verfügung gestellten Grundstück, aber keine nach einem Gesamtplan angelegte Gartenstadt, die ein umfassenderes städtebauliches Konzept erfordert hätte. Für eine Gartenstadt war die Werkbundsiedlung auch zu klein. Ein Ursprung der Werkbundsiedlung, der den Begriff „Gartenstadt“ erklären mag, ist allerdings in der Wiener Siedlerbewegung der frühen 1920er-Jahre zu suchen. Um der unmittelbaren Not der Nachkriegszeit zu entkommen, wurden damals große Siedlungen mit Nutzgärten zur Selbstversorgung angelegt. Die Gärten der Werkbundsiedlung dienten allerdings nicht mehr in erster Linie der Selbstversorgung, sondern vor allem der Erholung. Jedes Grundstück hatte eine Fläche von ca. 200 m².
Die Gestaltung der Gärten
Die Gartengestaltung war bewusst zurückhaltend und einheitlich, um den zukünftigen BesitzerInnen nicht zu viele Vorgaben zu machen. Anstelle von Zäunen wurden zwischen den Gärten Ligusterhecken gepflanzt. Vom Vorgarten zum Hauseingang und von der Gartenseite bis zum Ende des Grundstücks wurden Wege mit Natursteinplatten verlegt. Pergolen aus Holz oder Eisen wurden aufgestellt und bildeten geschützte Sitzplätze. In mehreren Häusern wurden darüber hinaus schon für die Ausstellung 1932 individuelle Gartengestaltungen durchgeführt. Die Häuser von Oskar Strnad erhielten Pflanzungen der Staudengärtnerei „Windmühlhöhe“, die im Besitz von Hanny Strauß war. Den Wohnhof von Haus Nr. 16 gestaltete der Gartenarchitekt Alois Berger, die Gartenarchitektin Grete Salzer schuf die Gärten der Häuser Nr. 45 und Nr. 46 von Jacques Groag. Nach dem Ende der Ausstellung ließen die KäuferInnen des Hauses Nr. 62 den Garten von dem aus Deutschland stammenden Gartenarchitekten Willi Vietsch gestalten, der selbst eine Zeit lang in der Werkbundsiedlung wohnte.
Haus und Garten
Die Verbindung von Haus und Garten war ein zentrales Thema der Wiener Architektur der Zwischenkriegszeit. Häuser sollten im Lauf der Jahre mit dem sie umgebenden Garten verwachsen und dadurch mit der Natur verwoben werden – eine Vorstellung, die Oskar Strnad am Beispiel seines Doppelhauses erläutert hat: „Wie der Baukörper als solcher sich gegen die Sonne streckt, sich gegen die Natur öffnet, wie er sich gegen Wind und Wetter abwehrt, wie der Garten in den gebauten Fußboden übergeht und wie die Zimmerwände ins Freie hinausragen. Es ist der Zusammenklang der Natur mit den zum Sinn gewordenen geometrischen Formen, die aber mit der Erde verwurzelt sind.“
Text: Andreas Nierhaus