Haus Lurcat (Nr. 25-28)
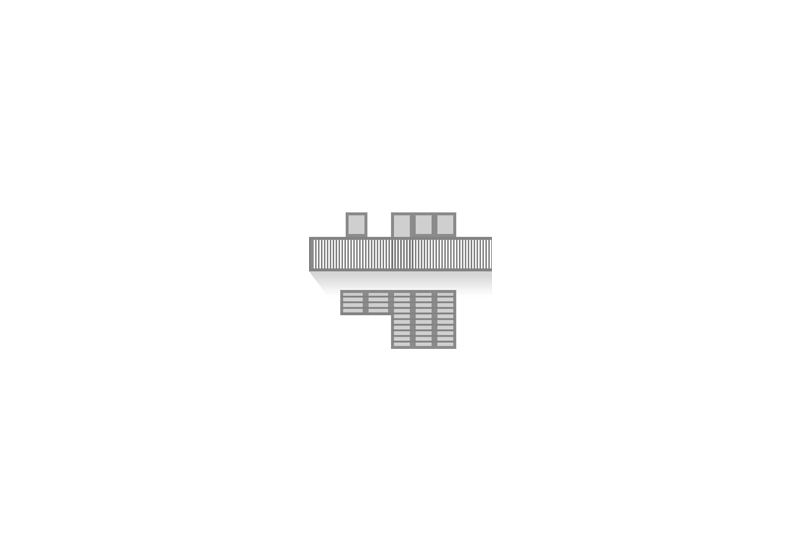
Straßenansicht
© Adsy Bernart
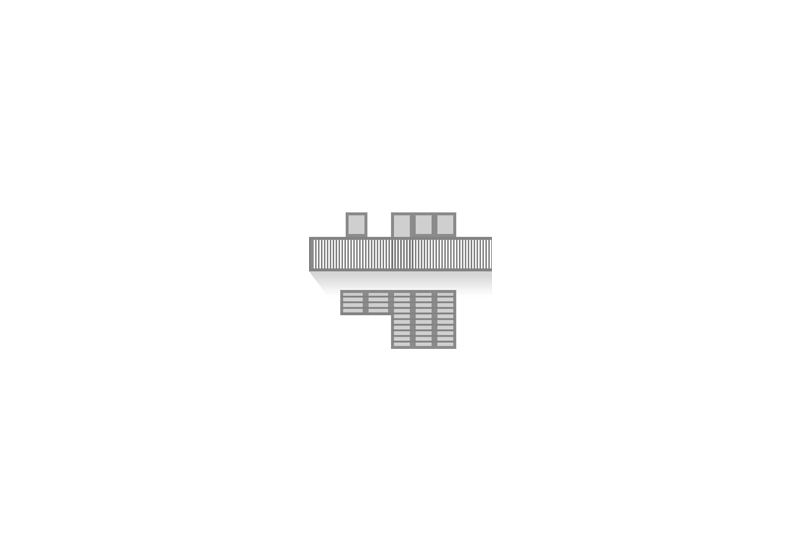
Straßenansicht
© Adsy Bernart
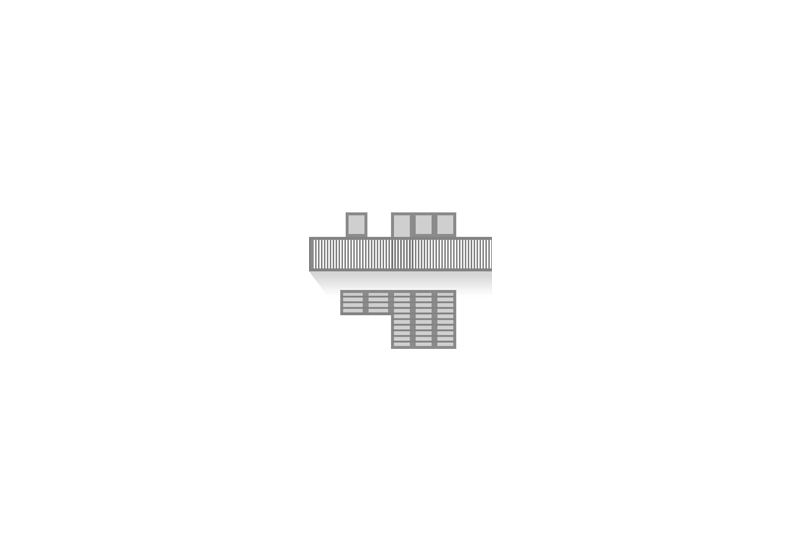
Gartenfassade
© Adsy Bernart
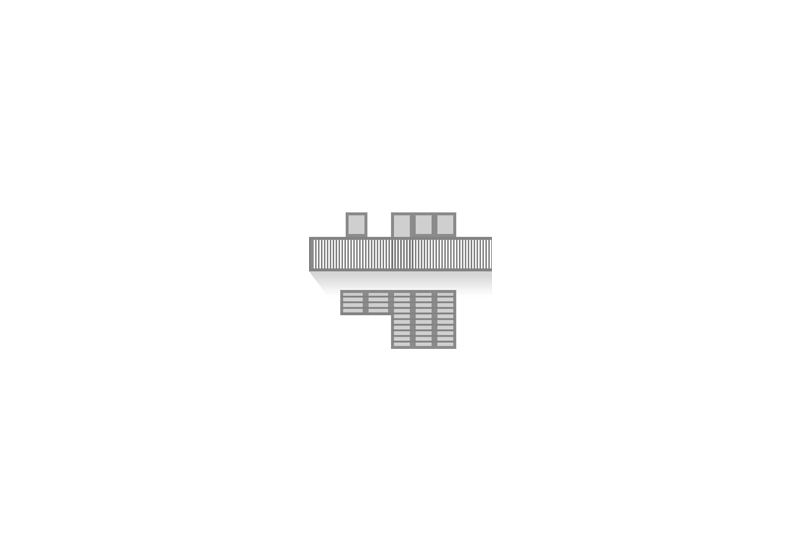
Straßenansicht
Martin Gerlach jun. © Wien Museum
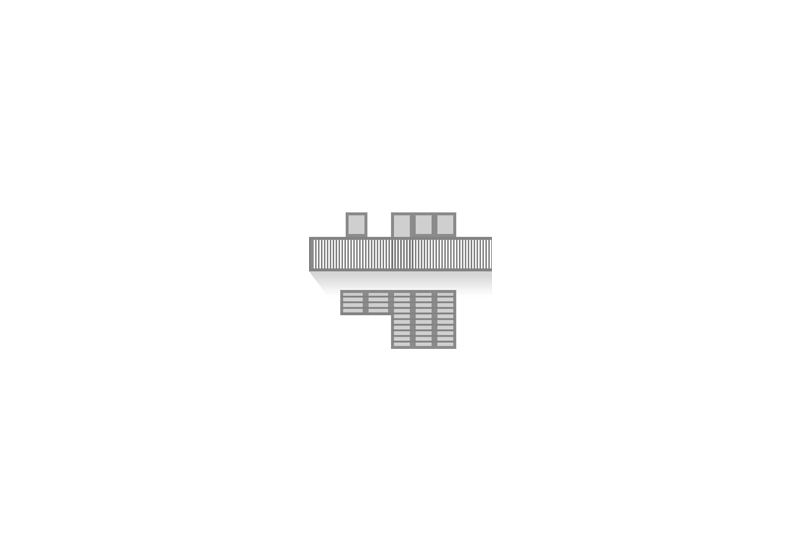
Straßenansicht
Martin Gerlach jun. © Wien Museum
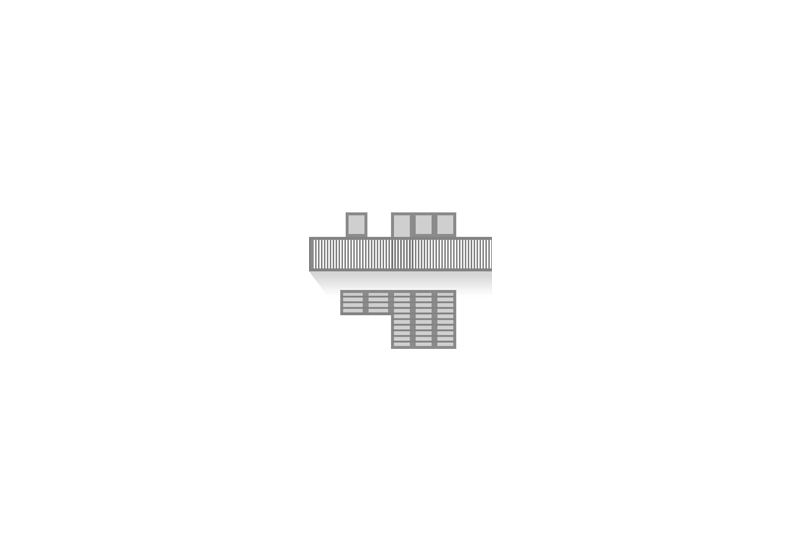
Gartenfassade
Martin Gerlach jun. © Wien Museum
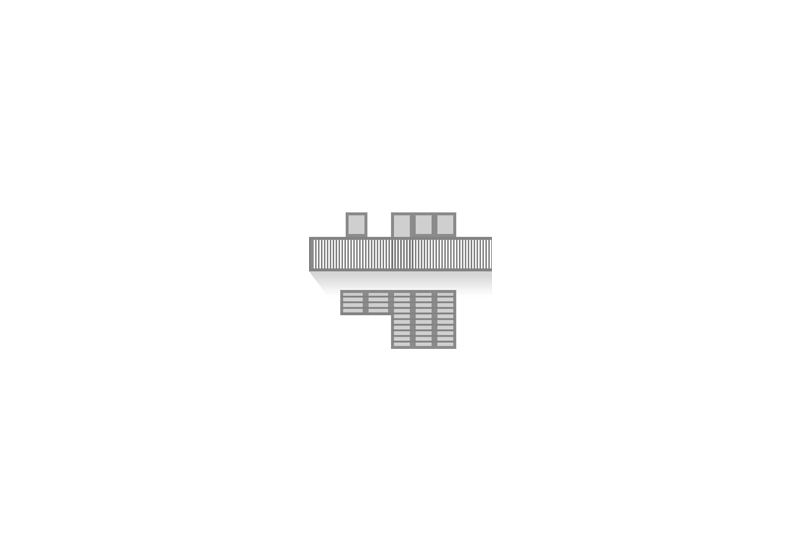
Wohnraum Haus 25
© Wien Museum
Architekt
Inneneinrichtung
Adresse
Veitingergasse 87, 89, 91 und 93
Verbaute Fläche
38 m²
Die Reihenhäuser von André Lurçat, einem der bekanntesten Vertreter des Funktionalismus in Frankreich und Gründungsmitglied der CIAM – Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (Internationale Kongresse Moderner Architektur), zählen mit ihrer geschlossenen blockhaften Gestaltung und den vor die Front gesetzten abgerundeten Stiegenhäusern zu den markantesten Bauten der Wiener Werkbundsiedlung. Der abweisende Charakter der straßenseitigen Fassade wird zusätzlich noch durch die wenigen schmalen – beinahe schießschartenartigen – Fensterschlitze und die geschoßhohe Vorgartenmauer unterstrichen. Völlig unterschiedlich dazu präsentiert sich die Fassade zum Garten: Hier öffnet Lurçat die Räume der beiden Obergeschoße mittels durchgehender Fensterbänder Richtung Süden – ein Kontrast, wie er stärker kaum sein könnte. Die in Weiß gehaltene Häuserzeile mit den dunkelgrauen Bandfenstern und der durchgehenden Dachterrasse (nur von Haus Nr. 25 zugänglich) weist an der gegen die Stadt gerichteten Schmalseite den leuchtend roten Schriftzug „Wiener Werkbundsiedlung 1932“ auf.
Die vier nach Süden ausgerichteten Häuser mit einer Wohnfläche von je 68 m² sind streng in drei etagenweise getrennte Funktionsbereiche gegliedert. Bei einer verbauten Fläche von nur je 38 m² war es dabei notwendig, die Verkehrswege im Haus auf ein Minimum zu reduzieren. Die Grundfläche der Reihenhäuser ist im Erdgeschoß nur etwa zur Hälfte verbaut und weist neben dem Wirtschaftsbereich mit Windfang, Vorraum, Waschküche, Keller und Lagerraum einen überdeckten Sitzplatz samt Durchgang zum Garten auf (wurde später zugemauert). Über das aus dem Baublock herausgerückte Stiegenhaus mit Kunststeinstufen gelangt man in das erste Obergeschoß, das neben dem Wohnzimmer auch die Küche, eine Kammer und das WC umfasst. Einen Stock höher betritt man einen kleinen Vorraum, von dem aus man in zwei Schlafräume gelangt, die durch ein in der Mitte liegendes Badezimmer getrennt sind. Die Kritik an den Bauten von André Lurçat richtete sich neben dem Vorwurf des abweisenden Charakters und der für die geografische Lage ungünstigen Fensterwahl vor allem gegen die Grundrisskonzeption, welche die Notwendigkeit des ständigen Stiegensteigens mit sich brachte.
Für die Möblierung seiner Häuser hatte André Lurçat die Verwendung variabler Möbel wie etwa Klappbetten und Klapptische vorgesehen. Grundrisszeichnungen zeigen Vorschläge für jeweils eine Tages- und eine Nachtmöblierung, wie sie beispielsweise im zweiten Obergeschoß aussehen könnte: Tagsüber sind die Betten hochgeklappt und „verschwinden“ in der Einbauwand, wodurch die Schlafräume auch untertags benutzbar werden und den BewohnerInnen somit zusätzlicher Wohn- und Aufenthaltsraum zur Verfügung steht. Lurçat steht mit diesen Überlegungen zur Rationalisierung der Wohnungen mittels Einbaumöbel nicht alleine da, vielmehr war dieses Thema seit Beginn der 1920er-Jahre Inhalt zahlreicher Kongresse, Publikationen und Ausstellungen.
Text: Anna Stuhlpfarrer
Historische Grundrisse
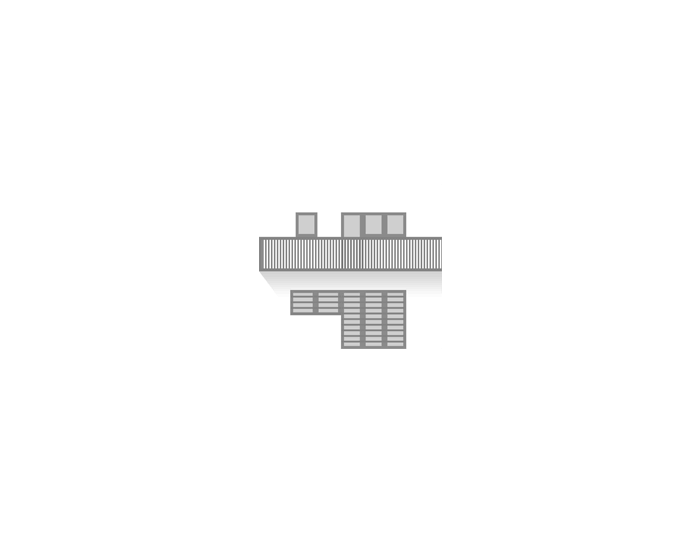
Erdgeschoß Haus 25
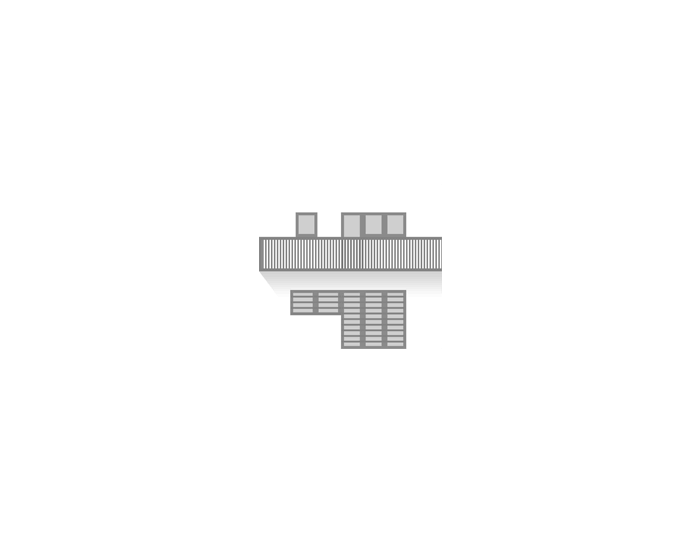
1. Stock Haus 25
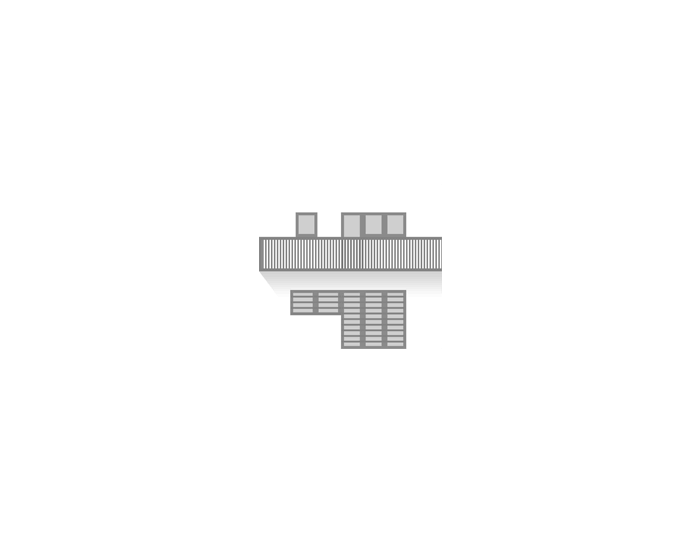
2. Stock Haus 25
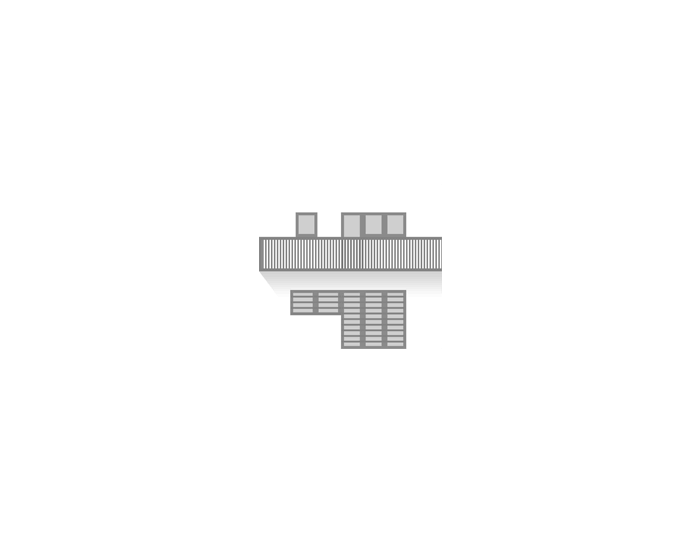
Dachgeschoß Haus 25
Visualisierungen
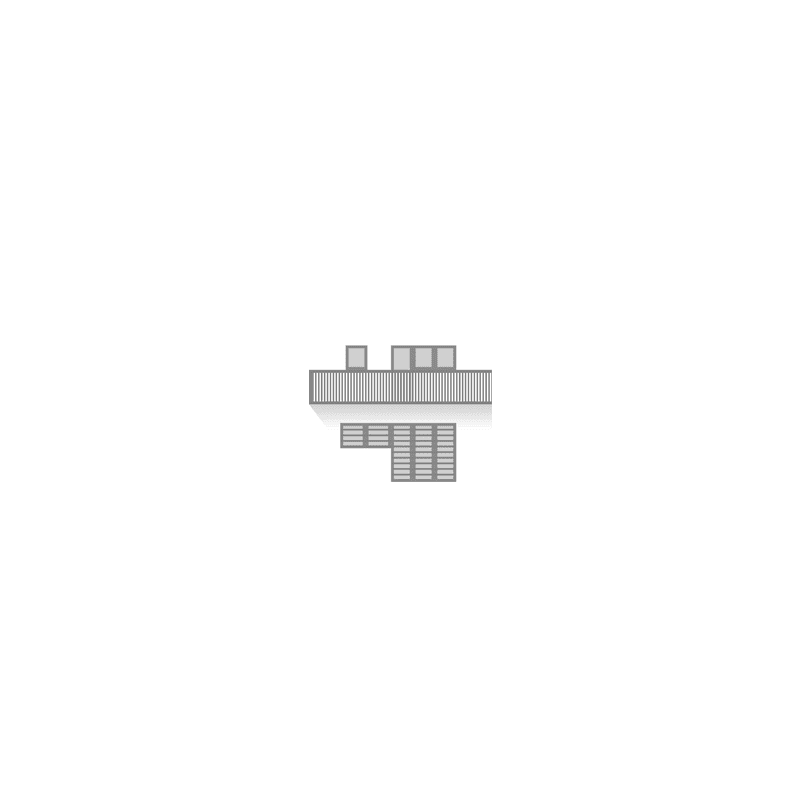
Haus 25 – 28, Lurçat
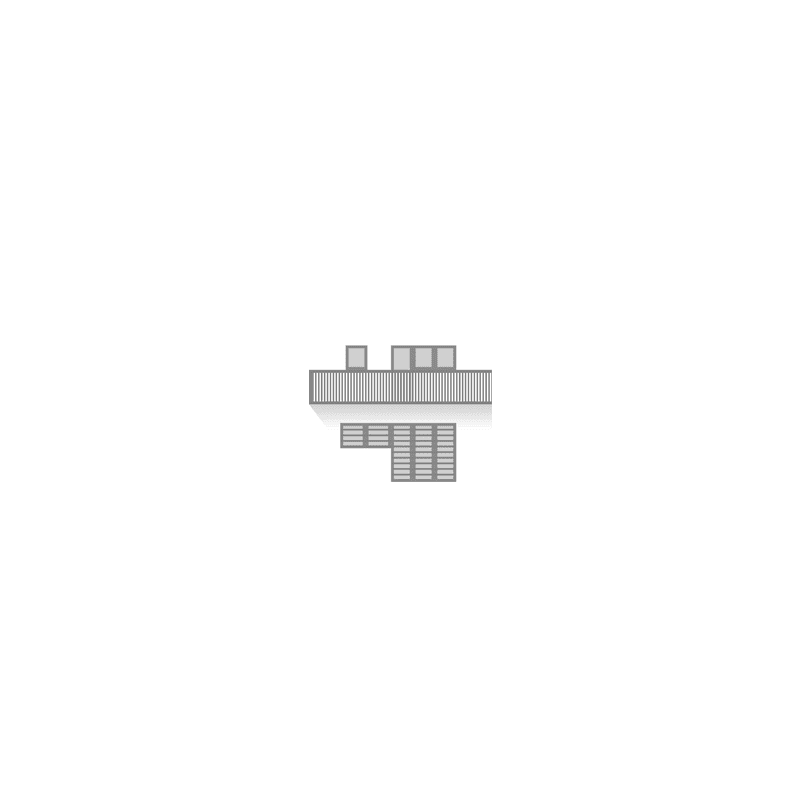
Haus 25 – 28, Lurçat
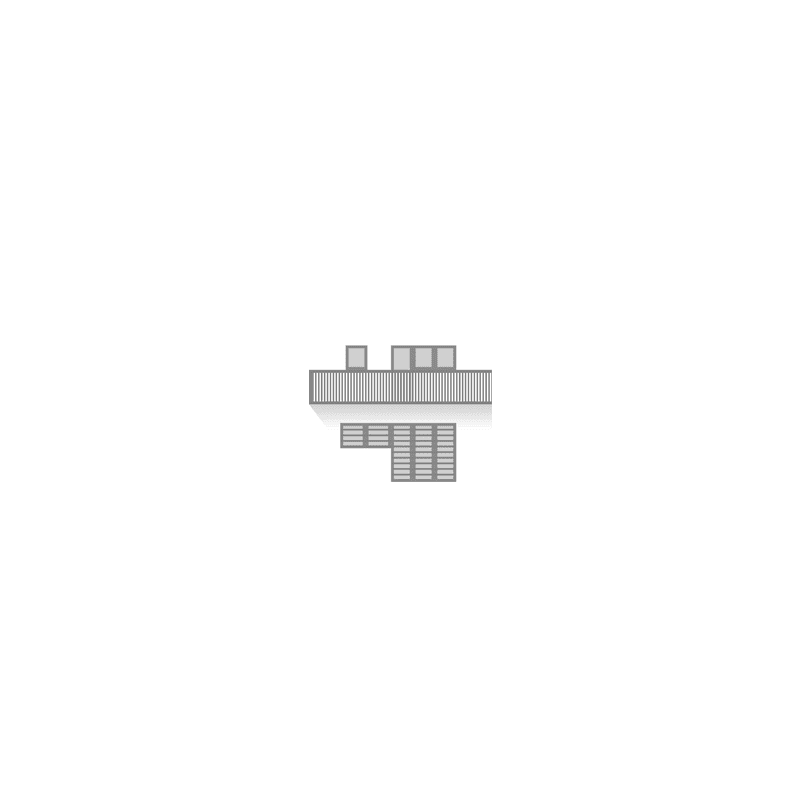
Haus 25 – 28, Lurçat
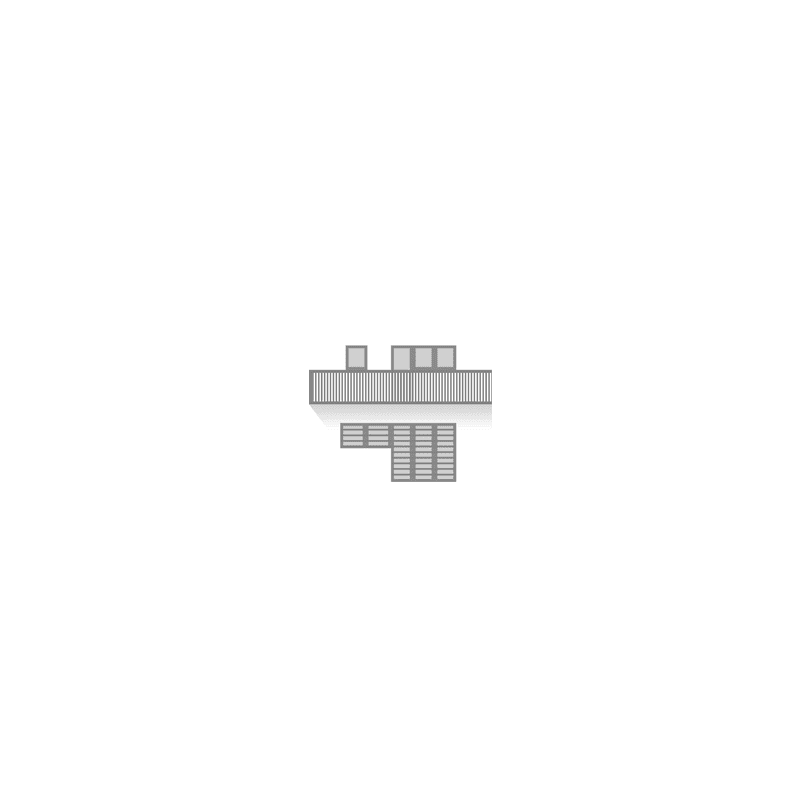
Haus 25 – 28, Lurçat
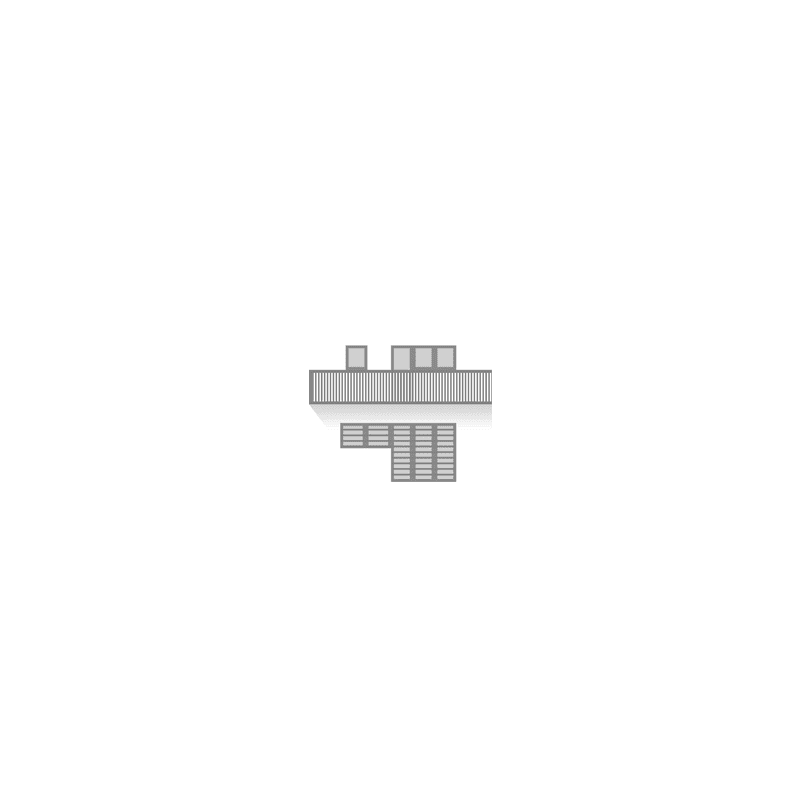
Haus 25 – 28, Lurçat